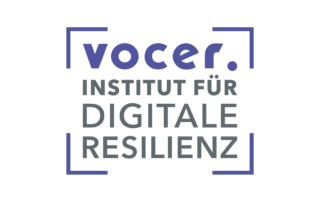In Zeiten von sozialer Polarisierung, digitaler Erschöpfung und medialer Desorientierung müssen alle Medien stärker zusammenarbeiten. Wir sollten den gemeinwohlorientierten Journalismus nicht mehr als Sozialromantik, sondern als wirksames Gegengift zu KI-gesteuerter Desinformation denken. Dazu braucht es neue medienpolitische Weichenstellungen und endlich ein klares Bekenntnis aus Berlin.
Von Stephan Weichert
Deutschland verharrt in der Zukunftsdebatte des Journalismus seit Jahren im Standby-Modus. Die Medienpolitik pendelt derweil zwischen Resignation und Attentismus, während viele Medienhäuser ums Überleben kämpfen. Der Politik fehlt, im Ganzen gesehen, der Mut zu einem klaren politischen Bekenntnis. Was die Ampel-Regierung nicht erreicht hat, könnte nun die neue Bundesregierung anpacken. Denn Lösungen gibt es wie Sand am Meer: Gemeinwohlorientierte Medien stärken, lokaljournalistische Gründungen gezielt fördern, in Weiterbildung investieren, Digitalkonzerne regulieren.
In den USA zählt die Organisation Institute for Nonprofit News (INN) mittlerweile mehr als 475 steuerlich anerkannte Redaktionen – ein rasant wachsender Sektor. Die Investigativ-Schwergewichte „ProPublica“ und das „Center for Investigative Reporting“, das bereits 1977 seine gemeinnützige Arbeit begann und unter dessen Dach seit kurzem die Mutter aller Nonprofit-Redaktionen – die legendäre „Mother Jones“ – erscheint, stehen exemplarisch für diesen Erfolg. Auch im Lokalen gibt es seit knapp zwei Jahrzehnten florierende gemeinnützige Redaktionen mit vielsagenden Namen wie „Voice of San Diego“, „CalMatters“, „The Texas Tribune“ und „MinnPost“ aus Minnesota.
Diese Nonprofit-Redaktionen finanzieren sich überwiegend durch Privatspenden und Stiftungsgelder und sind nach Paragraf 501(c)(3) des amerikanischen Steuerrechts steuerbefreit. Hinzu kommen investigative Redaktionen mit spezieller Ausrichtung wie „The Marshall Project“ (Strafjustizsystem), „Chalkbeat“ (Bildung), „The Trace“ (Waffengewalt) und „Grist“ (Klimawandel). Vor kurzem hat sich sogar die traditionsreiche „Salt Lake Tribune“ in einen gemeinnützigen Medienverlag umwandeln lassen.
Austrocknung öffentlicher Diskurse verhindern
Zugleich schließen die US-Redaktionen regionale oder thematische Lücken, die von anderen Medien nicht oder nur unzureichend abgedeckt werden. Im Lokalen sind sie das derzeit wirksamste Gegenmittel gegen die Ausbreitung sogenannter „Nachrichtenwüsten“ – also Regionen, in denen Lokalzeitungen bereits verschwunden sind. Sie bieten auch eine Antwort auf die wachsende Unsicherheit über die Zukunft des Journalismus in einem politischen Klima, in dem Journalisten zunehmend unter Druck geraten. Erst diese Woche berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, wie sich Donald Trump die Medien seines Landes gefügig machen möchte, indem er Journalisten und Redaktionen wiederholt einschüchtert, erpresst und mit Klagen droht. Ein klarer Verstoß gegen das Presserecht und ein Dolchstoß gegen die Grundprinzipien einer liberalen Demokratie.
Auch in Deutschland werden in den kommenden Jahren – besonders im ländlichen Raum – immer mehr Regionen vom Verschwinden journalistischer Angebote betroffen sein. Wir erleben bereits jetzt eine Verödung der Medienlandschaft. Wenn funktionierende Lokalmedien verschwinden oder ihre Berichterstattung reduzieren, trocknet der öffentliche Diskurs aus.
Um die damit verbundene Abwärtsspirale zu stoppen, müsste die Politik im Lokalen nachhaltige Innovationsfonds einrichten, die über die übliche Anschubfinanzierung von zwei bis drei Jahren hinausreichen. Journalistische Neugründungen brauchen Planungssicherheit, um nicht sofort wirtschaftlichem Druck ausgesetzt zu sein.
Nicht vom Wohlwollen einzelner Ministerien abhängen
Wer eine resiliente Informationsgesellschaft gestalten will, muss journalistische Strukturen systematisch und langfristig fördern – und nicht als bürokratische Lotterie organisieren. Eine für die Demokratie so systemrelevante Branche darf nicht vom Wohlwollen einzelner Ministerien oder der Entscheidungslogik einzelner Finanzbeamter abhängen. Was neben öffentlich-rechtlichen und privatwirtschaftlichen Medien fehlt, ist ein dritter Sektor: Redaktionen, die auf das Gemeinwohl zielen statt auf Rendite. Nur so gedeiht ein resilientes Mediensystem, das auch dann funktioniert, wenn die Marktlogik versagt. Und nur so verhindern wir, dass ganze Lokalredaktionen verschwinden und junge Talente ländliche Regionen verlassen.
Ein solcher Journalismus braucht rechtliche Sicherheit – konkret durch die Aufnahme journalistischer Nonprofit-Projekte in die Abgabenordnung, wie es jetzt im Koalitionsvertrag auf Seite 122 kurz und knapp festgeschrieben ist. Denn für das demokratische Miteinander unserer Gesellschaft ist nicht nur entscheidend, dass Medien existieren, sondern auch wie. Während in den USA längst hunderte Redaktionen steuerlich anerkannt sind, streiten wir hierzulande über Definitionen und, typisch Deutschland, über formale Zuständigkeiten. Der schwarze Peter wurde in der vergangenen Legislatur solange einem anderen Ministerium zugeschoben, bis die Koalition aufgelöst wurde.
Mithin wäre die gesetzliche Verankerung ein vergleichsweise kostengünstiger Schritt – und ein einfacher Hebel zur schnellen Herstellung demokratischer Medienresilienz. Es geht nicht darum, bestehende Modelle zu ersetzen, sondern das Marktgeschehen zu beleben: durch Redaktionen, die mitunter unabhängiger, experimentierfreudiger und innovationsoffener arbeiten können als profitorientierte Unternehmen. Derzeit hemmt besonders der wirtschaftliche Druck das journalistische Innovationsgeschehen.
Stille Krise im Lokalen
Regionen ohne eigene Berichterstattung kann sich keine Demokratie leisten. Was wir daher brauchen, ist ein radikal neuer Förderansatz. Der 2024 in Berlin gestartete Media Forward Fund (MFF) zeigt, wie eine strukturierte Förderung über die klassische Startfinanzierung hinaus aussehen kann. Mit einem Volumen von neun Millionen Euro unterstützt er die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für gemeinwohlorientierte Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Beispiele wie „Correctiv“ oder „Krautreporter“ zeigen, dass gemeinwohlorientierte Medien mit der richtigen Unterstützung auch wirtschaftlich tragfähig sein können – auch deshalb, weil sie nicht primär auf Profit ausgerichtet sind, sondern das Gemeinwohl in den Vordergrund stellen. Ihr Nutzerversprechen liegt auf dem Gedanken, der Gesellschaft etwas (zurück)zugeben. Das überzeugt Mitglieder, Spender und sonstige Förderer.
Hinzu kommt: Während Meta, X und TikTok längst den Takt bestimmen, fehlt in Deutschland wie auf EU-Ebene eine mutige Plattformstrategie. Sichtbarkeit gibt es nur gegen Datenpreisgabe. Was wir jetzt brauchen, ist ein europäisches Social-Media-Projekt – als öffentlich-rechtliche digitale Infrastruktur für alle, refinanziert durch eine konsequente Besteuerung der Plattformkonzerne. Initiativen wie die „Save-Social“-Kampagne mit deutschlandweiter Strahlkraft und rund 260.000 Unterzeichnern weisen möglicherweise den Weg.
Denn vor allem KI stellt nicht nur Medien selbst, sondern auch die Medienpolitik auf den Prüfstand. Sie müsste Angebote wie das Fediverse oder Mastodon gezielt fördern und zugleich die Marktmacht von Meta, TikTok, LinkedIn oder X konsequenter einschränken – etwa durch Abgabenmodelle, Strafzahlungen bei Datenschutzverstößen und die Reinvestition dieser Mittel in zugängliche europäische Plattformen.
Derweil hat Meta seine Nutzer mit unerhörten Vertragsbedingungen überzogen, die eine algorithmische, KI-gestützte Ausforschung per Default einfordern. Wer sich dem entzieht, verliert Reichweite – und damit Relevanz. Diese falschen Anreize sind bisher systemisch eingebaut.
Umso dringlicher wird eine klare Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte – ein „Gütesiegel für KI-Content“, vergeben durch eine unabhängige Ethikinstanz. Denn in Zeiten synthetischer Information geht vor allem das Vertrauen in Medien und demokratische Institutionen verloren.
Demokratie braucht resiliente Medienstrukturen
Gleichzeitig wächst die Sorge vieler Journalisten, in der KI-Welt abgehängt zu werden. Viele erleben die aktuellen Umwälzungen als professionelle Bedrohung: Was ist meine Rolle, wenn ein Avatar mein Erscheinungsbild und meine Stimme imitiert oder ein Sprachmodell Texte für mich schreibt?
Die Antwort liegt meines Erachtens vor allem in journalistischer Aufklärung und in kontinuierlicher Weiterbildung. Das VOCER-Institut hat gemeinsam mit starken Partnern wie dem Deutschen Journalisten-Verband, der Medienanstalt Hamburg/ Schleswig-Holstein und der Bundeszentrale für politische Bildung seit der Corona-Pandemie über 500 Medienschaffende in zahlreichen Akademien überwiegend kostenfrei weiterqualifiziert – und wir sind zum Glück nicht die einzigen. Ein Beleg für den exorbitanten Bedarf und dafür, dass Weiterbildung kein Luxus bleiben darf. Auch solche Initiativen brauchen öffentliche Unterstützung.
Was nun?
Es reicht nicht, dieselben medienpolitischen Lippenbekenntnisse zu recyceln. Deutschland braucht endlich echten Gründerspirit im Mediensektor. Gemeinnütziger Journalismus sollte dazu gesetzlich verankert, lokale Redaktionen strukturell gestärkt werden. Weiterbildung wiederum muss dauerhaft kostenfrei für alle Journalist:innen zugänglich sein.
In unsicheren Zeiten müssen alle Akteure in den Medien stärker zusammenarbeiten: Nonprofit-Journalismus ist, im Ganzen gesehen, keine Konkurrenz zu klassischen privatwirtschaftlichen oder öffentlich-rechtlichen Medien, sondern ihre notwendige Ergänzung. Der Blick über den Atlantik zeigt, warum das funktioniert: Die nicht auf Profite ausgerichteten Medienhäuser arbeiten auf höchstem professionellem Niveau und ergänzen das bestehende Medienökosystem.
Schrumpfende Zeitungen, entstehende „Nachrichtenwüsten“ und KI-Monopole: Der Journalismus steuert auf mehrere Kipppunkte zu. Die Politik hat lange genug gezögert, die medienpolitischen Versprechungen der vergangenen Jahre mit echten Strukturreformen zu flankieren. Es wurde zu viel gemeckert und zu wenig geklotzt. Die neue Bundesregierung sollte das Momentum nutzen, um strukturelle Reformen für den Erhalt des demokratierelevanten Journalismus auf den Weg zu bringen – als wirksames Gegengift gegen soziale Polarisierung, digitale Erschöpfung und mediale Desorientierung.
Das gemeinnützige VOCER-Institut hat zuletzt das Policy Paper „Refounding Democracy 2025“ gemeinsam mit führenden Köpfen aus Journalismus und Zivilgesellschaft erarbeitet. Das Papier wird am 10. Juli 2025 in Berlin dem zuständigen Referat des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien übergeben.
Was das VOCER-Institut in seinem Policy Paper fordert – und fördert:
Bildnachweis: KI-Generiert. NEWS DESERTS: KI-Zyklus zur Expansion von Nachrichtenwüsten und Pressesterben #31 © 2024-2025 Stephan Weichert / VOCER-Institut für Digitale Resilienz
Dr. Stephan Weichert

Dr. Stephan Weichert ist Medienwissenschaftler, Publizist sowie Mitgründer und Direktor des gemeinnützigen VOCER-Instituts für Digitale Resilienz. Gemeinsam mit Dr. Leif Kramp ist er redaktioneller Projektleiter von NPJ.news.
Foto: Martin Kunze
Forum & Debatte
Was macht gemeinnützigen Journalismus aus? Warum braucht es ihn? Wie können seine wirtschaftlichen und juristischen Rahmenbedingungen verbessert werden? Was macht seine gesellschaftliche Akzeptanz aus? In dieser Rubrik bieten wir Gastautor:innen ein offenes Forum für einordnende Debattenbeiträge, Essays, Berichte und Interviews. Die unterschiedlichen Sichtweisen, Positionen und Perspektiven sollen die Debatte über die Sinnhaftigkeit und die Zielsetzungen des gemeinnützigen Journalismus in Deutschland beleben. Es handelt sich um einordnende Gastbeiträge, deren Auswahl durch die NPJ.news-Redaktion erfolgt, die aber nicht zwingend die Meinung der Redaktion wiedergeben.