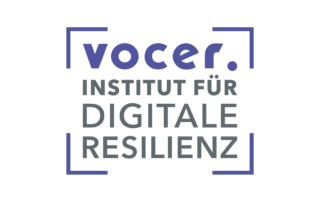Unsere Demokratie wankt nicht nur an den Rändern, sie verliert auch ihre kulturelle Strahlkraft. Während rechte Kräfte einfache Antworten liefern, verharren Progressive oft im Defensivmodus. Was fehlt, ist – wie der SPD-Politiker Carsten Brosda gerade forderte – eine „andere Idee“: eine positive Erzählung, die Lust auf Zukunft macht. Diese Erzählung wächst nicht in den Metropolen, sondern dort, wo Demokratie alltäglich gelebt wird – im Dorf, am Küchentisch, beim Streit im Verein. Genau hier beginnt die „360-Grad-Resilienz“, die unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert braucht.
Von Stephan Weichert
„Was Republiken auszeichnet, ist das beständige, lustvolle Reden aller mit allen. Doch in den Demokratien der Gegenwart fehlen Begegnungsräume im Alltag, in denen die Vielfalt moderner Gesellschaften erlebbar wird. Eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“
Mit diesen Worten bringt der Politikwissenschaftler und Autor Rainald Manthe in seinem Buch „Demokratie fehlt Begegnung“ (2024) die Essenz demokratischer Kultur auf den Punkt. Demokratie lebt nicht allein von Institutionen, Verfassungen und Wahlen, sondern vor allem von Begegnung: vom Austausch im Alltag, im Verein, am Küchentisch oder beim Fest im Dorf. Dort, wo Menschen einander zuhören, streiten und gemeinsame Lösungen suchen, entsteht Vertrauen. Wo das Gespräch verstummt, wächst dagegen der Boden für Misstrauen, Spaltung und autoritäre Versuchungen.
Wenn wir heute über den zunehmend brüchigen Zustand der Demokratie sprechen, schauen wir fast reflexhaft in die Metropolen. Berlin, Hamburg oder München gelten als Taktgeber für gesellschaftliche Innovationen, während die ländlichen Räume im politischen Diskurs oft als Rückzugsorte oder – schlimmer – als Problemzonen erscheinen. Doch die eigentliche Nagelprobe für die Zukunft unserer Demokratie findet nicht in den Großstädten statt, sondern jenseits der Ballungsräume – dort, wo Polarisierung, Abwanderung und Politikverdrossenheit besonders virulent, wenn auch nicht überall sichtbar sind.
Wir holen die Menschen an einen Tisch
Die Corona-Pandemie hat diese Bruchlinien schonungslos offengelegt: Während digitale Technologien die Städte vernetzt und produktiv gehalten haben, blieben viele Dörfer in struktureller und kultureller Isolation zurück. Zugleich wuchsen hier Skepsis gegenüber staatlichen Institutionen und Misstrauen gegenüber demokratischen Prozessen. Nicht zufällig konnte gerade in ländlichen Regionen die Zustimmung zu autoritären und populistischen Strömungen besonders an Boden gewinnen.
Was also tun, wenn das demokratische Fundament dort wackelt, wo Gemeinschaft und Gemeinsinn historisch am stärksten verwurzelt sein sollten?
Unsere Antwort lautet: Wir müssen die Resilienz unserer Demokratie neu erlernen und ermöglichen – und zwar vor Ort, im Alltag der Menschen, mit ihnen gemeinsam. „Demokratie-Resilienz“ bedeutet mehr, als nur Wahlen abzusichern oder Institutionen zu stärken. Es geht darum, das Vertrauen in die demokratische Idee zurückzugewinnen und Räume zu schaffen, in denen Bürgerinnen und Bürger wieder unmittelbar erfahren, dass sie selbst Akteure dieses Wandels sind.
Skepsis gegenüber „Zugezogenen“ ist groß
Genau hier setzen die aus den DIALODGE-Bildungsprogrammen resultierenden experimentellen Formate wie das „Dorf Dialog Dinner“ (DDD) an. Der von uns verfolgte Ansatz ist simpel und zugleich auf gewisse Weise konsequent: Wir holen die Menschen an einen Tisch – buchstäblich. Bei gemeinsamen Mahlzeiten in Dorfgemeinschaftshäusern und Kreativorten wie dem „Alsenhof“ in Lägerdorf nahe Hamburg entsteht eine Atmosphäre, in der die „feinen Unterschiede“ (Pierre Bourdieu) die Menschen nicht sofort trennen, sondern in der zunächst alles geteilt wird: das Brot, die Zeit, die Aufmerksamkeit. Solche Begegnungen sind keine Folklore, sondern soziale Erneuerung im besten Sinne: Sie eröffnen Gesprächsräume, in denen auch kontroverse Themen wie Digitalisierung, Klimakrise oder der Umgang mit Rechtspopulismus verhandelt werden können, ohne sofort in ideologische Schützengräben zu zurückzufallen.
Natürlich ist das kein Selbstläufer. Wer heute im ländlichen Raum Demokratieprojekte initiiert, stößt nicht selten auf Widerstände. Die Skepsis gegenüber „Zugezogenen“ oder externen Initiativen ist groß, das Misstrauen gegenüber allem, was nach „Belehrung von oben“ klingt, nach wie vor tief verwurzelt. Manche Gemeinderäte blockieren, sobald sich politische Mehrheiten verschieben, andere Bürgerinnen und Bürger reagieren mit Ablehnung, sobald fremde Kennzeichen im Dorf parken. Es wäre naiv, diese Realitäten zu ignorieren. Doch gerade hier entscheidet sich, ob unsere Gesellschaft die Kraft hat, derlei Spaltungen zu überwinden.
Resilienz heißt in diesem Kontext: Frustrationen aushalten, Konflikte aushandeln, Brücken bauen – auch wenn sie noch etwas instabil wirken. Und es bedeutet, lokale Strukturen so zu unterstützen, dass sie nicht von Förderlogiken oder kommunalpolitischem Kleinmut erdrückt werden. Projekte wie das DDD können nur dann nachhaltig wirken, wenn es Förderkulissen gibt, die Gemeinwohlorientierung belohnen, anstatt sie in ökonomische Zwänge zu pressen. Demokratiearbeit im ländlichen Raum sollte oder vielmehr: darf nicht an Pachtforderungen oder befristeten Projektmitteln scheitern.
Gesellschaftliches Immunsystem im Kleinen
Reinald Manthe erinnert daran, dass Demokratie vor allem alltägliche Begegnungsräume des sozialen Zusammenhalts braucht – Orte, an denen Menschen zusammentreffen, die sonst kaum Berührung hätten. Eine Politik, die auf Durchmischung setzt, die Förderung von Vereinen und Ehrenamt ebenso wie auf Investitionen in Begegnungsinfrastrukturen in ländlichen und strukturschwachen Regionen, schafft genau solche Räume. Dort, wo Menschen mit unterschiedlichen Lebensumständen und Ansichten in Kontakt kommen, wächst nicht nur Verständnis für Vielfalt, sondern auch die Fähigkeit, gerade die Unterschiedlichkeit als Wert einer liberalen Gesellschaft zu begreifen und diese zu leben.
Während politische Thinktanks wie das VOCER-Institut von „Demokratie-Resilienz“ oder das Zentrum Liberale Moderne in ihrem Policy Paper von „360°-Resilienz“ sprechen – also einer umfassenden Widerstandsfähigkeit gegenüber multiplen Krisen –, zeigen innovative Dialogformate wie das DDD, wie diese Resilienz im Alltag konkret heruntergebrochen wird. Dort, wo die Notwendigkeit besteht, sich auf die Gleichzeitigkeit von Krisen – Klimawandel, Desinformation, Energieknappheit, geopolitische Spannungen – vorzubereiten, übersetzt unser Ansatz dieses Makrodenken ins Lokale: Wenn Menschen lernen, sich auszutauschen und Konflikte auszuhalten, entsteht so etwas wie ein gesellschaftliches Immunsystem im Kleinen, von dem eine Gestaltungskraft im Großen ausgehen kann.
Entscheidender Hebel: gemeinnütziger Journalismus
Hier knüpft das Prinzip der Gemeinwohlökonomie unmittelbar an. Wer ernsthaft über die Zukunft von Dörfern und Kleinstädten nachdenkt, muss ökonomische Logiken neu justieren: weg von kurzfristiger Profitmaximierung, hin zu langfristigem gesellschaftlichem Nutzen. Gemeinwohlorientierte Projekte erzeugen Werte, die sich nicht in Bilanzen messen lassen: Vertrauen, Zusammenhalt, Teilhabe. Sie brauchen deshalb Förderstrukturen, die diese immateriellen „Renditen“ anerkennen und absichern. Gerade im ländlichen Raum entscheidet sich, ob wir den Mut haben, Gemeinwohl als neue Leitwährung zu etablieren.
Gleichzeitig geht es um Haltung. Wir dürfen nicht müde werden, für die Idee der Demokratie zu werben – nicht abstrakt, sondern praktisch erfahrbar: im Gespräch mit der Nachbarin, im Austausch mit dem Bürgermeister, in einer Debatte am Küchentisch. Demokratie ist kein theoretisches Konstrukt, sie ist gelebte Praxis. Und sie braucht Orte, an denen diese sichtbar und spürbar wird.
Ein entscheidender Hebel ist dabei auch der gemeinnützige Journalismus. In vielen ländlichen Regionen haben sich lokale Redaktionen zurückgezogen oder wurden von großen Medienhäusern ausgedünnt. Zurück bleibt ein Informationsvakuum, das von Desinformation, Gerüchten und Populismus gefüllt wird. Hier können gemeinnützige Modelle gegensteuern: unabhängige, lokal verankerte Redaktionen, die nicht auf Klickzahlen schielen, sondern im Auftrag der Öffentlichkeit arbeiten. Sie sind Seismografen für lokale Stimmungen, Plattformen für Dialog und Frühwarnsysteme für demokratische Erosion. Für Institutionen wie das VOCER-Institut ist das keine Randaufgabe, sondern Kernauftrag: Journalismus als Daseinsvorsorge.
Das „unsichtbare Drittel“
Auch das Zentrum Liberale Moderne weist zu Recht darauf hin, dass kritische Infrastrukturen geschützt werden müssen. Wir erweitern diesen Gedanken: Auch Informations- und Begegnungsräume sind kritische Infrastrukturen – ohne sie zerfällt der gesellschaftliche Zusammenhalt in tausend kleinste Scherben. Das DDD ist damit mehr als ein Beteiligungsformat, es ist eine Art „Resilienz-Training“ für unsere Demokratie im Alltag.
Methodisch lässt sich dies durch die Arbeit von More in Common belegen. Die internationale Organisation untersucht den gesellschaftlichen Zusammenhalt und hat mit dem Konzept des „unsichtbaren Drittels“ empirisch sichtbar gemacht, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung im Diskurs kaum vorkommt. Diese Menschen sind weder lautstark polarisierend noch fest verankert im demokratischen Engagement, sie suchen Orientierung und Anschluss. Sie entscheiden langfristig über die Stabilität unserer Gesellschaft, doch im öffentlichen Resonanzraum bleiben sie weitgehend opak und unsichtbar. Dieses Drittel lässt sich nicht durch schrille Botschaften gewinnen, sondern durch Begegnungen, die auf Vertrauen und Zugehörigkeit setzen. Auch hier setzt das DDD aktiv an: Es öffnet Räume, in denen das unsichtbare Drittel nicht übersehen, sondern als aktive Stimme einbezogen wird.
Wie etwa Siri Hummel, die Direktorin des Maecenata Instituts in Berlin, betont, ist es gerade die Zivilgesellschaft, die unser Gemeinwesen trägt: „Ohne die zigtausend Initiativen und Organisationen und die Millionen Freiwilligen in Deutschland wäre unsere Gesellschaft nicht denkbar – besonders beeindrucken mich Projekte, die ‚bottom up‘ für Menschenrechte, Gleichstellung oder Demokratie kämpfen. Oder Projekte, bei denen Leute ‚einfach machen‘ und aus dem Nichts heraus wunderbare menschliche Verbindungen entstehen.“ Diese Perspektive verdeutlicht umso mehr: Begegnung und demokratisches Engagement entstehen nicht durch Verordnungen von oben, sondern dort, wo Menschen ins Handeln kommen – pragmatisch, solidarisch, oft aus der Situation heraus.
Begegnung als leibhaftige Herausforderung – 5 Handlungsschritte
Aus den Erfahrungen der DIALODGE-Bildungsprogramme im ländlichen Raum und speziell eines Formats wie dem DDD ergibt sich ein konkreter Handlungsrahmen, wie Demokratie-Resilienz gestärkt werden kann:
- Demokratielabore etablieren – Veranstaltungen systematisch dokumentieren, qualitative Daten erheben und in Forschung, Publikationen und Empfehlungen überführen.
- Toolkit für Kommunen entwickeln – Handreichungen für Gemeinden, wie Dialog- und Beteiligungsformate gelingen können, inklusive Moderationsdesign und Impulsstruktur.
- Train-the-Trainer-Programme starten – Weiterbildungen für lokale Akteure, die Dialogkultur eigenständig verstetigen wollen.
- Journalistische Begleitung sicherstellen – Podcasts, Video-Reportagen oder Essays, die Dialogprozesse sichtbar machen und unabhängige professionelle Medien als Brückenbauer stärken.
- Skalierung über Netzwerke – ein Verbund von Dörfern und Regionen, der Teilhabe-Indikatoren wie Vertrauen, Vielfalt und Dialogkultur misst und öffentlich macht.
Demokratie-Resilienz wächst also dort, wo Begegnung zur leibhaftigen Herausforderung wird – am Dorftisch, im Gespräch, im Streit und im Versuch, Zukunft gemeinsam zu gestalten. Sie lebt davon, das unsichtbare Drittel einzubeziehen, Gemeinwohlökonomie zur Leitwährung zu machen und Journalismus als demokratische Daseinsvorsorge zu stärken. Im Sinne einer „Rundum-Resilienz“ dürfen wir nicht länger nur aufs große Ganze schauen. Widerstandskraft entsteht nicht allein in Ministerien, durch Strategiepapiere oder bei EU-Gipfeln – sie wächst in den alltäglichen Begegnungen von Menschen. Demokratie beginnt, wenn wir uns trotz aller Unterschiede ernsthaft aufeinander einlassen.
Doch das allein reicht nicht. Wie Carsten Brosda in den Neuen Frankfurter Heften betont, dürfen progressive Kräfte sich nicht damit begnügen, den autoritären Versuchungen nur ein defensives „Nein“ entgegenzuhalten. Demokratie braucht eine andere Idee – eine positive, zukunftsweisende Erzählung, die Lust auf eine gemeinsame Zukunft macht. Diese Idee entsteht nicht in den Kulturkämpfen der Talkshows oder in den Leitartikeln der großen Zeitungen, sondern in der Praxis des Miteinanders: wenn Menschen im Dorf oder in der Kleinstadt erfahren, dass sie selbst Träger und Gestalter der Demokratie sind.
Die eigentliche Herausforderung besteht also darin, aus den vielen lokalen Experimenten, Begegnungen und Erzählungen eine größere Vision zu formen: eine demokratische Kultur, die nicht nostalgisch zurückblickt, sondern nach vorne zeigt. Demokratie-Resilienz beginnt im Kleinen – doch sie entfaltet ihre eigentliche Strahlkraft, wenn sie Teil einer solchen „anderen Idee“ wird – ein Leitmotiv, das unsere freiheitliche Gesellschaft nicht nur verteidigt, sondern neu umwirbt.
Bildnachweis: KI-Generiert. NEWS DESERTS: KI-Zyklus zur Expansion von Nachrichtenwüsten und Pressesterben #37 © 2024-2025 Stephan Weichert / VOCER-Institut für Digitale Resilienz
Dr. Stephan Weichert

Dr. Stephan Weichert ist Medienwissenschaftler, Publizist sowie Mitgründer und Direktor des gemeinnützigen VOCER-Instituts für Digitale Resilienz.
Fotos: VOCER-Institut/ Martin Kunze
Forum & Debatte
Was macht gemeinnützigen Journalismus aus? Warum braucht es ihn? Wie können seine wirtschaftlichen und juristischen Rahmenbedingungen verbessert werden? Was macht seine gesellschaftliche Akzeptanz aus? In dieser Rubrik bieten wir Gastautor:innen ein offenes Forum für einordnende Debattenbeiträge, Essays, Berichte und Interviews. Die unterschiedlichen Sichtweisen, Positionen und Perspektiven sollen die Debatte über die Sinnhaftigkeit und die Zielsetzungen des gemeinnützigen Journalismus in Deutschland beleben. Es handelt sich um einordnende Gastbeiträge, deren Auswahl durch die NPJ.news-Redaktion erfolgt, die aber nicht zwingend die Meinung der Redaktion wiedergeben.