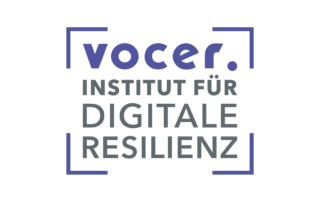In einer Welt permanenter Krisenmeldungen, algorithmischer Entmündigung und wachsender Nachrichtenmüdigkeit wird Digitale Resilienz zur Überlebensfrage der Demokratie. Sie entsteht nicht von selbst, sondern durch unabhängigen Journalismus, individuelle Selbstfürsorge der Nutzenden und eine kluge Medienpolitik. Ein Appell für einen ganzheitlichen Ansatz, der die digitale Transformation umarmt.
Von Stephan Weichert und Leif Kramp
„Resilienter werden heißt widerstandsfähiger werden“, sagt der Soziologe Andreas Reckwitz. Dahinter stecke die Erwartung oder die Einsicht, dass bestimmte negative Ereignisse drohen, die man vermeiden oder in ihrer negativen Wirkung begrenzen will: „Es geht nicht mehr um Steigerung bisherigen Verhaltens, sondern um den Schutz vor Beschädigung, auch um die Einsicht in die eigene Verletzlichkeit“, so Reckwitz.
Doch taugt Resilienz auch als Leitkonzept für die Gesellschaft der Zukunft? Und (warum) kann unser Konzept der Digitalen Resilienz helfen, Bedrohungen, Schieflagen und Risiken zu bewältigen, die sich aus der digitalen Transformation im Allgemeinen und dem Mediengeschehen im Besonderen ergeben?
Unsere These: Die Widerstandskraft des digitalen Publikums hängt eng mit der Resilienz von Medienschaffenden zusammen. Betrachtet man das professionelle Feld des Journalismus genauer, wird klar, dass es zu seinen Aufgaben gehört, die öffentliche Sphäre – nicht nur, aber besonders – in Kriegs- und Krisenzeiten zu schützen. Journalismus muss also diese besondere Herausforderung irgendwie meistern – und dabei selbst resilient bleiben.
Wir können nur hoffen, dass KI-Systeme uns nicht ersetzen
Die von Reckwitz diagnostizierte Resilienz sollte in der digitalen Gesellschaft daher eine Aufwertung erfahren, weil es nicht nur um Selbstfürsorge, sondern auch um die Souveränität von Organisationen, Branchen und unserer Gesellschaft insgesamt geht. Wenn wir über Digitale Resilienz sprechen, sprechen wir also im Kern immer auch über die Resilienz von Demokratie: Wie schützen wir unsere Mitmenschen vor Demütigungen im Netz? Wie garantieren wir Pressefreiheit und Medienvielfalt? Wie gehen wir mit den drastischen Folgen der Künstlichen Intelligenz um?
Woran erkennt man Digitale Resilienz? Sieben Merkmale für den souveränen Umgang mit digitalen Medien
Reflektierte digitale Mediennutzung – Informationen werden bewusst ausgewählt, eingeordnet und nicht impulsiv geteilt.
Quellenkompetenz – Fakten prüfen, Manipulation erkennen, Desinformation entlarven – kritisch, klar und konsequent.
Souveräner Umgang mit Medienzeit – Reizüberflutung erkennen und durch klare Grenzen, bewusste Pausen und digitale Selbstfürsorge ausgleichen.
Kritische Technologieoffenheit – Neue Tools und Systeme aktiv prüfen und resilient nutzen, statt sie blind zu übernehmen.
Dialogfähigkeit statt Schwarz-Weiß-Denken – Zuhören, statt vorschnell zu verurteilen, ermöglicht Perspektivwechsel und stärkt sozialen Zusammenhalt.
Strukturelle Klarheit in Organisationen – Resiliente Teams verfügen über transparente Prozesse, gelebte Feedbackkultur und ethische Orientierung.
Demokratisches Bewusstsein – Digitale Resilienz heißt: sich einmischen statt zurückziehen – für Vertrauen, Beteiligung und Gemeinsinn.
Die Anforderungen an Digitale Resilienz steigen mit dem technologischen Fortschritt. Sie ist längst gelebte Praxis, prägt unsere Arbeitswelt, Wirtschaft und Politik. Gewiss scheint auch, dass es zur Regel werden wird, mit unvorhergesehenen Wendepunkten (Krisen) dauerhaft zurechtzukommen – in einer Dynamik, wie wir sie seit den vergangenen Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben.
Wir können hoffen, dass KI-Systeme uns Menschen privat oder am Arbeitsplatz nicht ersetzen, sondern uns Arbeit abnehmen, die menschenunwürdig ist oder uns nicht zufrieden macht. Oder dass digitale Technologie letztlich die Qualität unseres Zusammenlebens steigern kann, weil sie bestimmte Dinge erleichtert oder überhaupt ermöglicht. So könnte die Digitalisierung neue Gelegenheiten in Bezug auf demokratische Prozesse eröffnet – etwa für Menschen in Diktaturen, die Zugang zu Informationen bekommen, die ihnen der Propagandaapparat verwehrt. Oder dass sich die Möglichkeiten zum Dialog weltweit vervielfachen, um mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen, die geografisch oder ideologisch voneinander entfernt sind.
Digitale Technologien eröffnen zweifelsohne Chancen. Damit diese Potenziale wirken, braucht es jedoch digitale Resilienz, die digitale Souveränität, Selbstwirksamkeit und psychische Widerstandskraft zusammendenkt – getragen von einer vorausschauenden Medien- und Bildungspolitik sowie dauerhaftem zivilgesellschaftlichem Engagement. Unabhängiger Journalismus ist dabei der entscheidende Resilienzfaktor. Um unsere Demokratie resilienter zu machen, müssen wir dafür sorgen, dass der Journalismus resilient bleibt.
Journalisten als Vertrauensanker
Als Gegengift zum Dauerkrisenmodus sollte uns generell daran gelegen sein, die gesellschaftliche Widerstandskraft zu fördern: eine innere Widerstandskraft, die Menschen hilft, in der Krise klarzukommen, indem sie aus der „Negativitätsspirale“ herausfinden und stärker in eine Gestaltungsrolle schlüpfen, um die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Die Blockaden, die ein selbstwirksames Verhalten in der Regel verhindern, haben mit psychischen Belastungsgrenzen zu tun. Diese sind individuell stets unterschiedlich, ebenso wie die sich daraus ergebenden Empfehlungen, wie die persönliche Widerstandskraft gesteigert wird.
Der ständige Krisenfokus in der Berichterstattung kann vor allem zu Desorientierung führen. Zwar ist das Vertrauen in Qualitätsmedien nach wie vor hoch. Aber der Befund, dass sie zunehmend mit der Kaskade an Negativität auch ihre Informationsgewohnheiten reduzieren, ist nur ein scheinbares Krisenparadoxon und als Entwicklung vor allem eines: alarmierend.
Weder Medienschaffende noch -nutzende können Krisen beeinflussen, geschweige denn unmittelbar steuern. Um Phänomenen wie „News Fatigue“ und „News Burnout“, also der totalen Erschöpfung infolge des intensiven digitalen Medienkonsums, beizukommen, kann guter Journalismus jedoch dazu beitragen, dass seine Nutzer:innen die Krisenlage umfassender einordnen und verarbeiten können.
Ein Problem bleibt dabei besonders virulent: Wie kann der Journalismus unsere Demokratie dauerhaft stärken und krisenfest werden, wenn er selbst unter Druck steht? Zum einen gilt es, die Hauptursache für misslungene Resilienz in der digitalen Transformation festzumachen; seit jeher schlägt hier die mangelnde Fähigkeit journalistischer Organisationen durch, sich zügig an veränderte Gegebenheiten anzupassen. Ohne kontinuierliche Weiterbildung und Inspiration von außen verfügen sie oftmals über wenig ausgeprägte Innovationsbereitschaft. Zum anderen sind die meisten journalistischen Organisationen selbst nicht robust, weil sie durchgehend von wirtschaftlichen Kalamitäten gebeutelt sind.
Das Modell des „resilienten Journalismus“
Ein Perspektivwechsel ist dringend nötig: Journalist:innen brauchen Selbstwirksamkeit, kontinuierliche Weiterbildung und Offenheit für neue Herangehensweisen. Unser Ansatz versteht „resilienten Journalismus“ als Strategiemodell unter den neuen Gesetzmäßigkeiten und Widrigkeiten der digitalen Transformation. Er erkennt die Ambivalenz digitaler Kommunikation an und legt den Fokus auf gesellschaftlichen Dialog, Zusammenhalt und Demokratie-Resilienz.
„Resilienter Journalismus“ meint einen ganzheitlichen, krisenorientierten Ansatz, der die Ambivalenzen digitaler Kommunikation einschließt; der die negativen Realitäten nicht negiert, sondern durch seinen empathischen Stil den gesellschaftlichen Dialog betont – und damit das transformative Moment: Indem der resiliente Journalismus nach dem „Wozu?“ in der Krise fragt, schreibt er den Medien die Rolle des Ermöglichers und Coaches zu, dem (selbstwirksamen) Publikum die Rolle des Krisenmanagers und fokussiert sich im Ergebnis der Berichterstattung auf die Festigung des gesellschaftlichen Zusammenhalts („Demokratie-Resilienz“). Im Gegensatz zu anderen Ansätzen soll der resiliente Journalismus das Publikum ermächtigen, (neue) Krisen aller Art proaktiv zu managen – vorausgesetzt, Journalisten sind selbst resilient.
So lassen sich beispielsweise an der Corona-Pandemie bestimmte Defizite journalistischer Berichterstattung ablesen: teilweise einseitig, unkritisch und unterkomplex, von der Wissenschaft teils als „regierungstreu“ eingestuft, mit unzureichender Aufarbeitung relevanter Spätfolgen – etwa der Veruntreuung von Corona-Hilfen in Deutschland, wirtschaftlichen Folgen für den globalen Arbeitsmarkt, Isolation vieler Menschen, Gesamtbelastungen für das internationale Gesundheitssystem oder der durch den dysfunktionalen öffentlichen Diskurs befeuerten sozialen Spaltung.
Ein ambivalentes Dreiecksverhältnis
Nichtsdestotrotz lohnt unser Erklärungsmodell des „resilienten Journalismus“ den Versuch, dass Medienmacher:innen die klassischen Rollenmuster und Denkschablonen selbstkritisch hinterfragen. Besondere Zeiten erfordern offenbar einen besonderen Journalismus, der seiner gesellschaftlichen Verantwortung und seinem Anspruch als wichtiges Bindeglied für das Selbstgespräch der Gesellschaft speziell im Krisen-Chaos gerecht werden kann.
Gerade im aktuellen Strukturwandel der digitalen Öffentlichkeit wird deutlich, dass eine demokratische Verfasstheit keine Selbstverständlichkeit ist. Wenn das digitale Miteinander zunehmend toxisch wird, steht dies einer Demokratie-Resilienz entgegen. Dann erweist sich sogar Journalismus als „Demokratie-Bremse“, wenn ihm in Phasen notwendiger Solidarität Glaubwürdigkeit und Krisenmanagement entgleiten.
Im „Zeitalter der digitalen Resilienz“ stehen digitale Transformation, Mediennutzung und Demokratie in einem ambivalenten Dreiecksverhältnis. Eine resiliente Gesellschaft ist auf resilienten Journalismus angewiesen – sonst dominieren Propaganda und Desinformation.
Zugleich ist es entscheidend, dass die Akteure im journalistischen Feld die Effekte ihrer Berichterstattung auf das Publikum und dessen Medienresilienz im Sinne einer Verantwortungsethik mitdenken. Das impliziert Risiken und Regelhaftigkeiten, denen nicht nur die Medienpraxis, sondern auch Akteure aus Zivilgesellschaft und Medienpolitik zu begegnen haben.
Das gemeinnützige VOCER-Institut hat zuletzt das Policy Paper „Refounding Democracy 2025“ gemeinsam mit führenden Köpfen aus Journalismus und Zivilgesellschaft erarbeitet. Das Papier wurde im Juli 2025 in Berlin dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) übergeben. Dieser Beitrag ist ein bearbeiteter Auszug aus ihrem aktuellen Buch „Resilienz in der digitalen Gesellschaft. Mediennutzung in Zeiten von Krisen, Kriegen und KI“, erschienen im Herbert von Halem Verlag, Köln (198 Seiten, 24 Euro).
Bildnachweis: KI-Generiert. NEWS DESERTS: KI-Zyklus zur Expansion von Nachrichtenwüsten und Pressesterben #38 © 2024-2025 Stephan Weichert / VOCER-Institut für Digitale Resilienz
Dr. Stephan Weichert

Dr. Stephan Weichert ist Medienwissenschaftler, Publizist sowie Mitgründer und Direktor des gemeinnützigen VOCER-Instituts für Digitale Resilienz.
Fotos: VOCER-Institut/ Martin Kunze
Dr. Leif Kramp

Dr. Leif Kramp forscht am Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung (ZeMKI) der Universität Bremen und ist Gründer sowie Vorstand von VOCER.
Fotos: Beate C. Köhler
Forum & Debatte
Was macht gemeinnützigen Journalismus aus? Warum braucht es ihn? Wie können seine wirtschaftlichen und juristischen Rahmenbedingungen verbessert werden? Was macht seine gesellschaftliche Akzeptanz aus? In dieser Rubrik bieten wir Gastautor:innen ein offenes Forum für einordnende Debattenbeiträge, Essays, Berichte und Interviews. Die unterschiedlichen Sichtweisen, Positionen und Perspektiven sollen die Debatte über die Sinnhaftigkeit und die Zielsetzungen des gemeinnützigen Journalismus in Deutschland beleben. Es handelt sich um einordnende Gastbeiträge, deren Auswahl durch die NPJ.news-Redaktion erfolgt, die aber nicht zwingend die Meinung der Redaktion wiedergeben.